
Graz knackt einen Forschungsjackpot
Was mit harter Arbeit in der Grundlagenforschung begann, reifte zu einer weltweit revolutionären Methode der 3D-Nanotechnologie. Einem Wiener Unternehmen verhalf die Innovation im Bereich „3D-Nano-Printing“ zum Einstieg einer millionenschweren US-amerikanischen Investorengruppe. Im Interview: Mastermind Harald Plank vom Institut für Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik (FELMI) der TU Graz.
Herr Professor Plank, steht man als Wissenschafter eines Tages auf und beschließt, heute starte ich das Projekt, das einen technologischen Durchbruch erzielt und international Aufsehen erregen wird?
Jein. Unser Ziel lautete tatsächlich, eine technologische Lücke zu schließen. Es gibt bereits etablierte und sehr erfolgreiche Fertigungsmethoden für Nano- bzw. Mikrostrukturen, auf denen unsere gesamte industrielle Produktion beruht. Sie stoßen in wesentlichen Punkten aber an ihre Grenzen: In den meisten Fällen funktionieren sie nur auf ebenen Oberflächen, wie in weiten Bereichen der Siliziumtechnologie. Zweitens bestehen diese Prozesse aus mindestens fünf Einzelschritten, was komplexe Anforderungen an die Produktion stellt. Letztlich ist die Fabrikation von komplexen, dreidimensionalen Architekturen enorm fordernd. Uns war schnell klar, dass wir also nicht etwas Bestehendes verbessern können, sondern breiter denken und eine völlig neue Methodik entwickeln müssen. Und wir wussten, dass es eine ganze Menge an Grundlagenforschung brauchen wird, um überhaupt dorthin zu kommen. Unser 3D-Nano-Printing war weltweit das erste seiner Art und markiert einen Paradigmenwechsel.
Können Sie sich an den Moment erinnern, an dem der Forschungsfunke gezündet hat?
Das kann ich konkret sagen: Es war 2013, mein Team und ich hatten bereits fünf Jahre Basisarbeit hinter uns, sozusagen die „hard fundamentals“. Da standen wir eines Tages am Institut in der Früh bei einem Kaffee zusammen und überlegten uns das Programm für eine Laborübung mit unseren Studierenden. Ich hatte Lust auf etwas Neues und fragte einen Kollegen: „Glaubst du, es funktioniert, wenn wir die Strukturen diesmal nicht vertikal hinauf, sondern schräg bauen, also leicht schief versetzt?“ Und er antwortete: „Ich glaube, das könnte klappen.“ An diesem Nachmittag haben wir die erste geneigte Struktur gebaut und ich begann zu begreifen, dass daraus etwas ganz Großes entstehen könnte.
Erläutern Sie uns Ihre Tätigkeit vereinfacht, damit sich der Laie etwas darunter vorstellen kann?
Stellen Sie sich vor, wir bauen miniaturisierte Wetterstationen aus Lego. Für gute Messergebnisse muss die Sensorik möglichst flexibel und intelligent sein. Indem wir die Legobausteine bzw. Moleküle schräg zusammensetzen, erzielen wir komplexe Strukturen in drei Dimensionen. Wir fixieren die Moleküle mit einem Elektronenstrahl an einem gewissen Ort und modifizieren sie, sodass das Material spezielle intelligente Eigenschaften erhält. Die Revolution liegt im Prozess – also in der Art und Weise, wie wir den Elektronenstrahl führen. Wir arbeiten quasi mit einem winzigen 3D-Drucker; der Elektronenstrahl misst einen Nanometer – ein 100.000stel eines menschlichen Haars. Damit sind feinste Elemente bis hinab zu etwa 10 nm möglich. Ein weiteres Asset: Der Prozess funktioniert auf jeder Oberfläche, ich muss nichts vorbereiten. Wenn Sie mir jetzt einen Bleistift geben, setze ich Ihnen eine 3D-Nanostruktur drauf.
„Es war großartig, mitzuerleben, wie das Ergebnis unserer Forschungsarbeit in die industrielle Fertigung einzieht.“
Insgesamt hat es nur rund 12 Jahre gedauert, die Methode zu perfektionieren und industriell anzuwenden.
Ja. In den folgenden Jahren haben wir uns in unserem weltweiten Netzwerk mit den richtigen Partnern zusammengetan. Wir arbeiten in einem Cross-over-Bereich, der Materialwissenschaft, Chemie, Physik und auch die Elektrotechnik in einem Projekt vereint. Einen wesentlichen Beitrag leisteten auch die Simulationsexperten der Oak Ridge National Labs bzw. der University of Tennessee in Knoxville (USA). Diese generieren Simulationen auf einem völlig anderen Level als wir hier in Graz. Wir konnten unsere Prozesse erstmals nachverfolgen, verstehen und so Voraussagen treffen, statt immer nach dem Trial-and-Error-Prinzip vorgehen zu müssen. Ein Meilenstein in unserer Entwicklung.
Um in die Anwendung zu kommen, haben Sie intensiv mit Unternehmen kooperiert.
2013 kam unser langjähriger Industriepartner an Bord, die Wiener GETec Microscopy GmbH, mit der wir 2018 ein mit mehr als zwei Millionen Euro dotiertes siebenjähriges Christian-Doppler-Labor gestartet haben: der Jackpot für jeden Wissenschaftler! Für das Unternehmen hingegen ein Wagnis: Wer verpflichtet sich schon für eine so lange Zeit? Da muss man schon einen sehr guten Grund haben.
Hatte GETec ein konkretes Ziel?
Richtig. GETec hatte sich mit einer eigenen Messtechnologie in einer Marktnische positioniert, dem Rasterkraftmikroskop (AFM). Es misst Oberflächenstrukturen und Materialeigenschaften im nanoskopischen Bereich, etwa auf Halbleitern, Polymeren, Keramik oder biologischem Material. Ziel war es, ihre Sensoren mithilfe unserer Prozesse drastisch weiterzuentwickeln und um vieles smarter zu machen. Das ist so gut gelungen, dass GETec 2018 von Quantum Design International in San Diego gekauft wurde: Ein Kaufargument war der Technologievorsprung aus unserem CD-Labor. 2024 stieg dann die US-amerikanische Investorengruppe Carlson Private Captial Partners ein und das Unternehmen entwickelt sich aktuell sehr stark weiter. Es war großartig, sich so zu beweisen und mitzuerleben, wie die eigene Forschung in die industrielle Fertigung einzieht.
Ein wissenschaftliches Märchen, könnte man sagen. Schreiben Sie weitere Kapitel?
Zu meiner großen Freude haben wir vor einem Jahr die Zusage für ein Infrastrukturprojekt des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhalten. Ende Juni wurde ein brandneues Multi-Ionenmikroskop an unserem Institut in Betrieb genommen, das uns ganz neue Möglichkeiten eröffnet: Wenn wir über die Elektronen hinaus auch mit Ionen arbeiten, können wir diese 3D-Strukturen nicht nur in einem einzigen Schritt komplexer gestalten, sondern auch intelligenter. Wir bekommen Zugang zu neuen Materialeigenschaften bis hin zur Quantenebene. Tatsächlich könnten wir damit zwei Kernprobleme lösen.
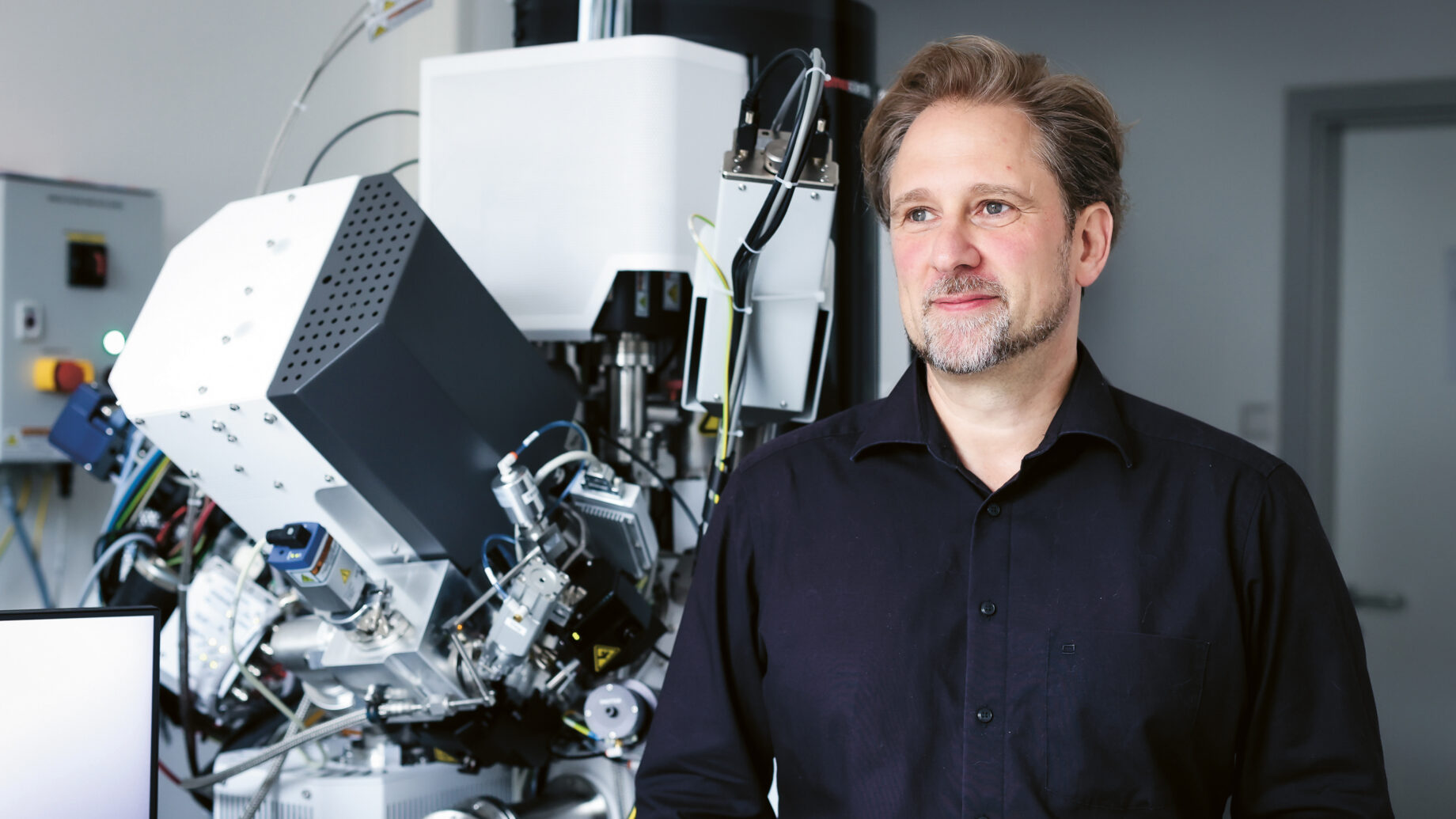
Was bewirkt Ihre Innovation konkret?
Für den End-User sind diese Technologien nicht sichtbar, obwohl die Messtechnik einen riesengroßen und global wachsenden Markt darstellt. Die Messsonden sind Teil zentraler Charakterisierungstechnologien in der produzierenden Industrie. Wir unterstützen die Produzenten also indirekt dabei, Materialien und Produkte effizient zu entwickeln und letztlich fehlerlos für den Endkunden zu fertigen. Wir arbeiten im Hintergrund, aber mit großer Hebelwirkung. Mein Kollege Dr. Robert Winkler bewirbt sich gerade um ein europäisches Forschungsprojekt im Bereich der Bio- und Medizintechnik, auch hier sehen wir ein Riesenpotenzial.
Sie waren weltweit die ersten, die diesen Durchbruch erzielt haben und haben damit internationale Aufmerksamkeit erlangt. Auch heute verfügt nur eine kleine wissenschaftliche Community über Ihre Expertise. Ergibt sich daraus dennoch eine Art Domino-Effekt für den gesamten Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Steiermark?
Also auf jeden Fall. Stellen Sie sich die vielen Industriebetriebe oder Forschungseinrichtungen vor, die vielleicht nicht genau an dem interessiert sind, was wir bisher gemacht haben, sondern daran, was man mit unserer Technologie noch alles bewirken kann. Hier entsteht ein deutlicher Dominoeffekt. Wir begegnen diesem Interesse auf unzähligen Konferenzen, der Rücklauf ist groß. Immer wieder fragen Universitäten oder Unternehmen an, die neue Anwendungsbereiche vorschlagen oder unsere Methode mit ihrem Kompetenzbereich „verheiraten“ wollen. Daraus entstehen wieder neue Projekte. Wir arbeiten an unserer Webpräsenz und knüpfen Kontakte in alle Welt. Der anfangs kleinen Community wachsen Äste in alle Kompetenzfelder – Kreativität und Kommunikation sind das Um und Auf.
Welche Fähigkeit zeichnet einen guten Wissenschafter aus?
Neben Kommunikationsfähigkeit und Freude am Austausch mit Kollegen auch eine sehr hohe Resilienz. Etwa zwei Drittel der wissenschaftlichen Arbeit sind Rückschläge. Wenn Sie damit nicht umgehen können, ist die Forschung ehrlicherweise nicht das Richtige für Sie. Mit der Zeit können Sie auf vergangene Erfolge zurückblicken und wissen, auch nach dem hartnäckigsten „Hänger“ kommt irgendwann wieder ein Durchbruch. Sie lernen Methoden, um an Probleme systematisch heranzugehen und entwickeln ein Grundvertrauen: Am Ende kommt etwas Sinnvolles heraus – egal, wie hart es begonnen hat.
Was wollen Sie im nächsten Jahrzehnt noch erreichen?
Mich interessiert das Thema Künstliche Intelligenz und wie wir unsere Technologie mit der KI kombinieren können. Ich würde die Technologie gerne noch leistungsfähiger machen und neue, bisher unerschlossene Anwendungskonzepte umsetzen. Es sind 12 Jahre bis zu meiner Pension, da geht sich das bestenfalls aus.
Geht ein leidenschaftlicher Wissenschafter überhaupt in Pension?
Ich weiß es noch nicht. (lacht)
Harald Plank
- geb. 1973 in Leoben
- Elektrikerlehre ebendort
- Studium der Technischen Physik an der TU Graz
- PhD 2007, Habilitation 2015
- Assoz. Prof. am Institut für Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik (FELMI) der TUG
- Wissenschafter am Zentrum für Elektronenmikroskopie (ZFE)
- Houska-Preis 2020 in der Kategorie „Industrienahe akademische Forschung“
- bis Feb. 2025 Leiter eines 7-jährigen, mit mehr als 2 Mio. Euro dotierten Christian-Doppler-Labors in Zusammenarbeit mit Industriepartnern – Entwicklung einer neuen Technologie (3D-Nanofabrikation mittels Elektronenstrahlen) bis zur Anwendung (industrieller 3D-Nanodrucker)
Nanostrukturen
Nanostrukturen haben das Potenzial, industrielle Prozesse zu revolutionieren und finden in vielen Bereichen Anwendung, darunter:
- Medizin, Energie, Elektronik und Materialwissenschaft
- In der Medizin ermöglichen sie eine gezielte Medikamentenabgabe und verbesserte Bildgebung.
- In der Energietechnik steigern sie die Effizienz von Solarzellen und Batterien.
- In der Elektronik führen sie zu kleineren, leistungsfähigeren und energieeffizienteren Bauteilen.
- In der Materialwissenschaft verbessern sie Eigenschaften wie Härte, Wärmeleitfähigkeit und optische Eigenschaften.
Fotos: Oliver Wolf




